Beim Jahres-Pressegespräch Sonderkulturen der Bayer CropScience Deutschland GmbH wurden neben den politisch-regulatorischen Herausforderungen die Unternehmensschwerpunkte in den Bereichen Pflanzenschutz und Gemüsesaatgut mit Fokus auf die anstehende Saison 2025 präsentiert.
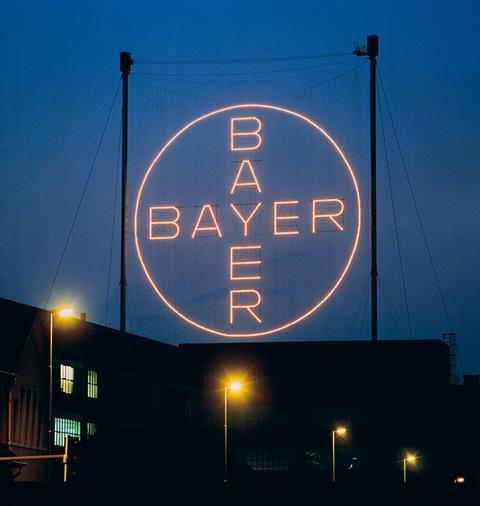
Die Herausforderungen, wie Ertragssicherung, Zulassungssituation im Pflanzenschutz oder auch Klimawandel, bleiben unverändert groß bzw. haben sich sogar weiter verschärft. In ihrer Präsentation zeigte Karin Guendel Gonzalez, Geschäftsführerin der Bayer CropScience Deutschland GmbH, wie das Unternehmen den Herausforderungen begegnet und auf Basis des höchsten Forschungsetats der Branche auf nahezu alle pflanzenbaulichen Fragestellungen Lösungen anbieten kann.
Im politischen Kontext hat es die Branche insgesamt nach wie vor schwer, die Bedeutung der Landwirtschaft, wie bspw. mit Blick auf die Ernährungssicherung für Gesellschaft und Menschen, zu vermitteln. „Die fehlende Akzeptanz spiegelt sich vielfach noch immer in einer unzureichenden Wertschätzung für die geleistete Arbeit in der Landwirtschaft wider“, sagte Karin Guendel Gonzalez eingangs.
Für Bayer, als ein Vertreter der forschenden Industrie, kommen gesellschaftspolitische Hemmnisse hinzu, die es immer schwieriger machen, gute Pflanzenschutz-Lösungen für die landwirtschaftliche Praxis in time zu entwickeln. Die Folge: Trotz enormer Anstrengungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung leidet zunehmend die Verfügbarkeit von Wirkstoffen auf europäischer Ebene als auch von Pflanzenschutzmitteln hierzulande. So wurde bspw. der letzte neue Wirkstoff in der Europäischen Union (EU) im Jahr 2019 Industrie-übergreifend genehmigt. Seitdem sind aber 76 chemische Wirkstoffe weggefallen. Auch bei den biologischen Wirkstoffen sieht die Entwicklung ähnlich aus. Weitere 40 % der heute verfügbaren Wirkstoffe könnte dies in den nächsten zehn Jahren treffen. Je nach Schaderreger ist die Situation bereits heute als kritisch zu bezeichnen. Eine Konsequenz hieraus ist die steigende Anzahl von Notfallzulassungen, die ihrerseits immer stärker in die Kritik geraten.
Es besteht ein gesellschaftspolitischer Wille, den Pflanzenschutz-Einsatz weiter zu reduzieren. Daraus sind verschärfte Datenanforderungen, gefolgt von Komplexität und Unsicherheiten bei Zulassungsfragen bzw. administrative Überlastung der Bewertungsbehörden, erwachsen. Die daraus resultierenden hohen finanziellen Risiken und Marktunsicherheiten führen zunehmend zu Investitionen der Industrie außerhalb der EU.
Dies läuft der Unternehmens-DNA von Bayer zuwider, das seine Wurzeln in Europa beziehungsweise in Deutschland hat. Guendel Gonzalez hob den Stellenwert hervor: „Mehr als 20 % der Mitarbeitenden des Konzerns arbeiten in Deutschland, die Hälfte der Konzernausgaben in Forschung und Entwicklung werden in Deutschland investiert und auch 30 % der Ertragssteuern bleiben hierzulande. Das Vertrauen in den Standort Deutschland ist trotz vieler Unwägbarkeiten nach wie vor auch bei der Division CropScience da. Nicht umsonst investiert Bayer gerade am Standort Monheim 220 Mio Euro in die Forschung zur Umweltsicherheit. Dort entsteht ein neuer Gebäudekomplex mit Laboren, Büros und einem Gewächshaus, der auf einer Fläche von 28.000 Quadratmetern Platz für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet.“
Von der neuen Bundesregierung erhofft sich Bayer eine verlässlichere und effizientere Verwaltung im Zulassungsbereich für Pflanzenschutzmittel, die zu mehr Planungssicherheit führt und fordert diese auch aktiv ein. Statt einer reinen Gefahrenbetrachtung muss auf der Basis der Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln wieder stärker der Nutzen für die Produktion von Nahrungsmitteln einbezogen und das Zulassungssystem muss im Ergebnis gleichermaßen ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen berücksichtigen. Die bislang bekannten Pläne des neuen EU-Kommissars Christophe Hansen, der seine Agrarvision 2025 kürzlich veröffentlicht hat, stimmen zumindest hoffnungsfroh.
Konkret und kurzfristig fordert Bayer eine Entpolitisierung der Zulassung und mehr Wertschätzung und Realismus in der Debatte um Risiken und Nutzen von Pflanzenschutzmitteln. Für Deutschland bedeutet das einen einheitlichen Benehmens-Status der drei Bewertungsbehörden JKI, BfR und UBA, idealerweise gebündelt unter einem Ministerium, und damit die Stärkung des BVL als zentrale Zulassungsbehörde.
Karin Guendel Gonzalez formulierte die Bayer-Vision: „Das derzeitige Ausmaß der Wirkstoffverluste auf EU-Ebene sowie bei Produktzulassungen in Deutschland muss gestoppt werden. Wir brauchen mittelfristig eine fundamentale Neuausrichtung des Zulassungsprozesses von Pflanzenschutzmitteln – von Gefahren-basierten Ausschlusskriterien weg und hin zu wissenschaftlicher und Daten-basierter Risikobewertung als Grundlage für ein robustes und möglichst feldspezifisches Risikomanagement unter Nutzung der digitalen Chancen des 21. Jahrhunderts.“
Die konkreten pflanzenbaulichen Herausforderungen beim Pflanzenschutz hierzulande sind enorm. Zu nennen sind der anhaltende Wegfall zahlreicher Handlungsoptionen in den wichtigen Sonderkultursegmenten. Sei es der Echte oder Falsche Mehltau im Weinbau, Fungizide gegen Schorf im Kernobst, Grauschimmel bei Erdbeeren beziehungsweise Steinobst oder Mehltau bei Hopfen, um nur wenige Beispiele zu nennen.
„Alle diese Handlungsfelder und weitere erfordern dringlich Antworten. Bayer hat sie, wenn auch nicht jeder Wirkstoffwegfall sofort gleichwertig ersetzt werden kann. Aber: Jeder Anbauer und Berater kann sich auf die Kompetenz und Beharrlichkeit des Unternehmens verlassen, dass zu jeder Zeit Lösungen erarbeitet werden“, so Guendel Gonzalez. Entsprechend endete ihre Präsentation mit einem Appell an die Branche: “Im Zeichen größer werdender Herausforderungen werden Partnerschaft, Wertschätzung, Geschlossenheit und Loyalität zwischen allen Akteuren immer wichtiger. Wir als Bayer und als forschende Industrie hier in Deutschland setzen auf erstklassige Produkte und Dienstleistungen, die durch Qualität, Nachhaltigkeit und Service überzeugen. Wir arbeiten höchst motiviert daran, Wirkungslücken, zunehmende Resistenzen und schwindende Erträge zu bekämpfen und durch große Anstrengungen in der Forschung, der Beratung und im Feldversuchswesen Lösungen zu liefern, die die Probleme im Feld angehen. Wenn stattdessen günstige Alternativlösungen, die oft nicht nachhaltig sind, gewählt werden, macht dies das Investment in Forschung und Entwicklung fraglich.”
Beständigkeit als Innovation – Wiederzulassungen sichern Lösungen
In den vergangenen fünf Jahren hat Bayer zahlreiche (Wieder-)Zulassungen von Pflanzenschutzprodukten für Sonderkulturen erlangt. Besonders hervorzuheben sind die erfolgreiche Listung von Glyphosat in der Annex-I-Liste sowie die (Wieder-)Zulassungen innerhalb der Roundup-Familie. Darüber hinaus hat Bayer in diesem Zeitraum die Zulassung für vier Insektizide erwirkt: Movento SC & Movento OD, deren Zulassungen leider bereits wieder ausgelaufen sind, sowie Flipper und Sivanto Prime. Letztere dürfen in Deutschland aktuell nur im geschützten Anbau eingesetzt werden. Darüber hinaus konnten für mehrere Fungizide Neuzulassungen, Wiederzulassungen und Zulassungserweiterungen erreicht werden. In seiner Präsentation beleuchtete Markus Borkowski, Teamleiter für Sonderkulturen, die Bedeutung dieser Fungizid-Zulassungen für die Sonderkultur-Betriebe in Deutschland.
„Die Reaktion der Praxis auf Wiederzulassungen ist vielfach leider verhalten“, sagte Markus Borkowski. „Die umfangreiche Arbeit, auf die diese Zulassungen fußt, wird vielfach nicht sonderlich gewürdigt. Im Gegenteil, die Reaktionen sind nicht selten von Enttäuschung geprägt: Enttäuschung über Zulassungsunterbrechungen, gegebenenfalls reduzierten Aufwandmengen oder fehlenden Indikationen. Bisweilen besteht wenig Verständnis für die lange Dauer, die eine Wiederzulassung in Anspruch nimmt. Zulassungserweiterungen auf neue Kulturen oder Indikationen werden ebenfalls nicht als innovativ wahrgenommen, da das Produkt selbst bereits bekannt ist.“
Bayer-Fungizide für Kernobst
Der Kernobstanbau steht ab 2026 vor extrem großen Herausforderungen. Im Rahmen der neuerlichen Listung des Wirkstoffes Captan – heute die tragende Säule bei der Schorfbekämpfung – werden erhebliche Restriktionen entweder in der Anwendungshäufigkeit und/oder Aufwandmenge erwartet. Durch die Maßgabe des Handels in Deutschland, Äpfel mit Rückständen zugelassener Phosphonate nicht zu akzeptieren, fehlt eine wichtige Wirkstoffgruppe. Bayer könnte hier mit Luna Care eine Lösung bieten, wodurch sogar Behandlungen eingespart würden. Die ausbleibende Akzeptanz zugelassener Produkte versetzt regionale Anbauer in eine nachteilige Wettbewerbsposition, die nicht ausgeglichen werden kann und darüber hinaus die Erzeugung in Deutschland gefährdet.
Markus Borkowski zeigte eine Perspektive auf: „Vor diesem Hintergrund war die Wiederzulassung unseres Fungizids Flint ein Meilenstein. Aktuell arbeiten wir an der Zulassungserweiterung der wichtigen Indikation der pilzlichen Lagerfäulen. Gerade beim Lager-Schorf gilt: Diese Krankheit muss auf dem Feld, das heißt vor der Ernte, bekämpft werden. Ohne diese wichtige Zulassung ist eine sichere Bekämpfung dieses Erregers nicht möglich.“
Bayer-Fungizide für Erdbeeren
Dramatisch wird die Situation bei der Botrytis-Bekämpfung in Erdbeeren: Da die Pyrimethanile nur eine eingeschränkte Wirksamkeit in der Praxis bringen, liegt die Last aktuell auf nur drei Wirkstoffgruppen: Den SDHI-Fungiziden, sowie Switch und Teldor als Produkte – jeweils aus eigenen Wirkstoffgruppen. „Mit dem zu erwartenden Wegfall von Fludioxonil (Switch) wird Teldor zukünftig das einzige Fungizid sein, um einen Wirkstoffgruppenwechsel durchzuführen. Insofern war die erfolgreiche Wiederzulassung von Teldor der essentielle Baustein, um den Erdbeeranbau in Deutschland zu erhalten“, betonte Borkowski.
„Wir stehen aktuell an einer Abbruchkante: Die Wirkstoffverluste werden in den kommenden Jahren dramatische Auswirkungen für den Anbau hierzulande haben“, resümierte Borkowski.
Die Anbauer benötigen dringend wirkungsvolle Lösungen, um sichere Spritzfolgen und damit die Produktion von Lebensmitteln sicherzustellen. Insbesondere das Anti-Resistenzmanagement stellt bei der zunehmend eingeschränkten Verfügbarkeit von Wirkstoffen und der erforderlichen Behandlungsintensität in Sonderkulturen eine erhebliche Herausforderung dar. Gleichzeitig bildet es jedoch die tragende Säule eines nachhaltigen Pflanzenschutzes. Um auch in Zukunft wirksame Spritzfolgen zu gewährleisten, ist ein kontinuierlicher Wirkstoffwechsel unerlässlich.
„Bayer engagiert sich nicht nur für die Entwicklung neuer Produkte, sondern setzt sich auch aktiv für den Erhalt bewährter Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen ein. Mit unserem Portfolio der „beständigen Innovationen“ sichern wir damit langfristige Bekämpfungsstrategien in Sonderkulturen. Daher ist jede Wiederzulassung als ein entscheidender Baustein einer nachhaltigen Pflanzenschutzstrategie zu verstehen“, sagte der Teamleiter für Sonderkulturen.
Bewährte Erdbeersorten und Fortschritte in der ToBRFV-Resistenzforschung
Das Gemüsesaatgutgeschäft (Vegetables by Bayer) bedient sowohl den Freiland- als auch den geschützten Anbau mit seinen Marken Seminis und De Ruiter.
„Anhand klar definierter Bewertungskriterien entwickeln wir unser Tomatenportfolio weiter, insbesondere in Bezug auf ToBRFV-resistente Sorten. In diesem Jahr konnten wir bedeutende Fortschritte erzielen und arbeiten sowohl an der Weiterentwicklung unseres bestehenden Portfolios als auch an der Verbesserung der Resistenz bestehender Sorten, der sogenannten ‘Conversion‘ zu ToBRFV-resistenten Sorten“, erklärte Grit Vogt, Market Development Representative bei De Ruiter. „Durch die Kombination mehrerer Resistenzgene streben wir an, eine dauerhafte Resistenz zu erreichen und Anbauern eine langfristige Strategie zur Bekämpfung des ToBRFV / Jordanvirus zu bieten.“
Zusätzlich bot Vogt einen Einblick in das interne Bewertungsverfahren zur Resistenz gegen ToBRFV. „Durch diese erhöhte Transparenz in der Bewertung unserer Resistenzniveaus möchten wir Anbauern die Sicherheit bieten, den Anforderungen einer modernen Tomatenkultur gerecht zu werden.“ Die aktuellen Fortschritte beinhalten die Entwicklung von Sorten mit signifikant reduzierten Symptomen und einer verringerten Viruslast. Die ersten ‘Conversions‘ und weitere interessante Neuzüchtungen werden noch in diesem Jahr kommerziell verfügbar sein und bieten Vorteile wie höhere Brixwerte, verbesserte Fruchtqualität sowie Resistenz gegen Mehltau und Chladosporium.
Darüber hinaus gab Vogt Einblicke in die Weiterentwicklung des Anfang 2024 von NIAB übernommenen Malling-Zuchtprogramms. Neben bewährten Sorten, wie dem Juniträger Malling Centenary und dem Remontierer Malling Ace, befindet sich derzeit eine neue Sorte im Segment Juniträger in der Markteinführung. Diese Sorte zeichnet sich durch die für Malling-Sorten typischen Eigenschaften wie hohes Ertragspotenzial und gute Fruchtgröße aus, insbesondere durch eine verbesserte Resistenz gegen Kronenfäule (Phytophthora cactorum). In Versuchen in Großbritannien und Belgien im Jahr 2024 erzielte diese Sorte außerdem ein Ertragsplus von bis zu 20 % gegenüber Malling Centenary.